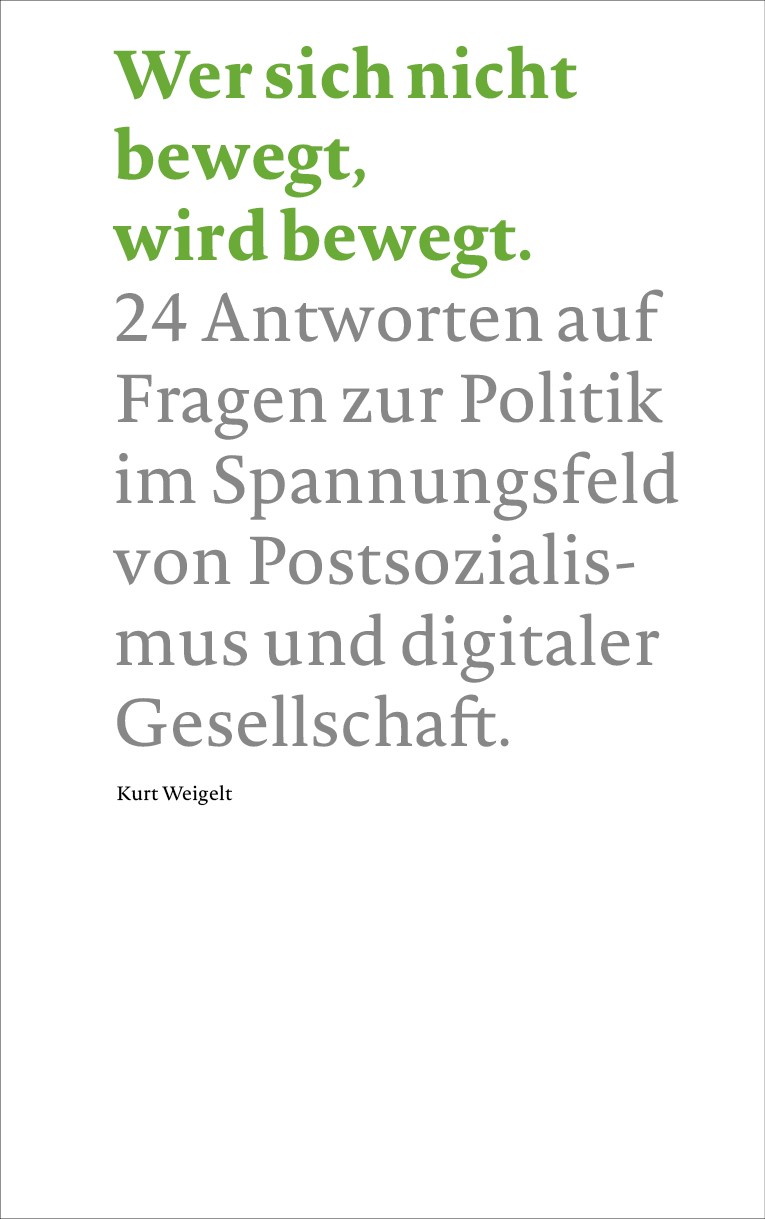Warum Konzerne das EU-Vertragspaket lieben – KMU jedoch skeptisch bleiben
Dies gelesen: «Vorstand des Gewerbeverbands beurteilt EU-Verträge kritisch und empfiehlt eine Abstimmung mit Ständemehr» (Quelle: SGV, Medienmitteilung, 17.10.2025)
Das gedacht: Für economiesuisse und den Arbeitgeberverband ist die Sache sonnenklar: Es führt kein Weg am EU-Vertragspaket vorbei. Im Vorstand von economiesuisse fiel der Entscheid mit 69:1 Stimmen bei zwei Enthaltungen.
Wesentlich zurückhaltender der Schweizerische Gewerbeverband. Dieser kritisiert in seiner Vernehmlassung das EU-Vertragspaket:
- Befürchtet wird eine Zunahme an Bürokratiekosten, eine Stärkung der Bundesverwaltung und eine Schwächung der demokratischen Einflussmöglichkeiten der KMU und der Schweizer Stimmbevölkerung.
- Darüber hinaus fordert der Gewerbeverband, dass die Abstimmung zum EU-Paket dem obligatorischen Referendum mit Ständemehr unterstellt wird.
Soviel zur verbandspolitischen Ausgangslage. Was steckt nun aber hinter der unterschiedlichen Haltung von Gewerbeverband und economiesuisse?
Konzerne vs. KMU – darum geht es
Auf einen ersten Blick lässt sich die Haltung des Gewerbeverbandes mit der Binnenmarktorientierung vieler Mitgliedunternehmen erklären.
Für ein Bauunternehmen, das den Schweizer Markt bearbeitet, hat die gegenseitige Anerkennung von Zertifikaten eine andere finanzielle Bedeutung als für eine international aufgestellte Herstellerin von Medizinalprodukten.
Geht man allerdings der Sache auf den Grund, dann zeigen sich die wesentlichen Unterschiede in den beiden Vernehmlassungen nicht in technischen Fragestellungen, sondern in der Beurteilung der institutionellen Regeln.
Die Vertreter des Gewerbes bewerten die dynamischen Rechtsübernahme weit kritischer als grosse Teile der Konzernwirtschaft.
Aus gutem Grund:
- Bürokratiekosten benachteiligen kleinere Unternehmen
Schon vor Jahren ergab eine durch das Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit (heute SECO) in Auftrag gegebene Studie, dass in Kleinstunternehmen mit 1 – 9 Mitarbeitern die administrativen Belastungen bedingt durch ihren Fixkostencharakter pro Kopf doppelt so viel kosten wie in Unternehmen mit 10 – 49 Angestellten.
Erst recht zeigt sich dieses Ungleichgewicht im Verhältnis zur Konzernwirtschaft. Skaleneffekte führen in grossen Unternehmungen zu einer im Verhältnis tieferen administrativen Belastung.
Dies gilt auch für die Regulierungskosten bei einer Übernahme von EU-Recht. Diese können von Grossunternehmen auf weit mehr Mitarbeiter verteilt werden. Ein Kostenvorteil, der die kleineren und mittleren Unternehmen benachteiligt.
Nicht weniger wichtig: Als Eintrittshürde schützen staatliche Regulierungen etablierte Unternehmen vor kleinen, aufstrebenden Konkurrenten. In dieses Bild passt die Forderung von OpenAI-Chef Sam Altman nach einer staatlichen Regulierung der künstlichen Intelligenz. Konzerne liebe Regulierung, so der Tages-Anzeiger.
- Unternehmer sind schlechte Befehlsempfänger
Das Institut für Unternehmensführung an der Fachhochschule Nordwestschweiz untersucht regelmässig die Motive, welche hinter dem Schritt zur Selbständigkeit stehen. Mit deutlichem Abstand an der Spitze stehen:
- das Streben nach Unabhängigkeit
- das Verfolgen einer sinnvollen Tätigkeit
- die Durchsetzung eigener Ideen
- das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung.
Die Hoffnung auf ein besseres Einkommen und ein höheres Ansehen spielen dagegen nur eine untergeordnete Rolle. Diese Absichten kommen an zehnter, respektiver zwölfter Stelle.
Privates Unternehmertum hat sehr viel mit der Absicht zu tun, selbst entscheiden und eigenverantwortlich handeln zu können.
Unternehmer sind schlechte Befehlsempfänger. Im Gegensatz zu vielen Konzernmanagern sind sie nicht bereit, ihre politischen Einflussmöglichkeiten einer weitergehenden Integration in die EU zu opfern.
Unterschiedliche Strukturen mit unterschiedlichen Spielregeln
In der Gegenüberstellung von kleineren und mittleren Unternehmen und Konzernwirtschaft geht es nicht darum, wer besser oder schlechter ist. Entscheidend ist vielmehr, dass es um unterschiedliche Strukturen mit unterschiedlichen Spielregeln und unterschiedlichen Bedürfnissen geht.
Vergleichbares gilt für das Verhältnis der Schweiz zu Brüssel. Das von unten nach oben gebaute politische System der Schweiz und die verwaltungs- und justizlastige Europäische Union sind nicht kompatibel. Diese Tatsache lässt sich mit keiner Werbekampagne und keiner Bundesratsrede aus der Welt schaffen.
Die dynamische Rechtsübernahme und die Übersteuerung unserer Institutionen durch den Europäischen Gerichtshof gehen an die Substanz unserer direkten Demokratie. Auf der Strecke bleibt das Erfolgsmodell Schweiz.
Unbeantwortet bleibt mit dieser Feststellung die Frage, warum viele Vertreter der Konzernwirtschaft dies nicht sehen wollen. Mangelt es an staatspolitischem Sachverstand oder fehlt ganz einfach die Bereitschaft und der Mut, öffentlich Stellung zu beziehen?