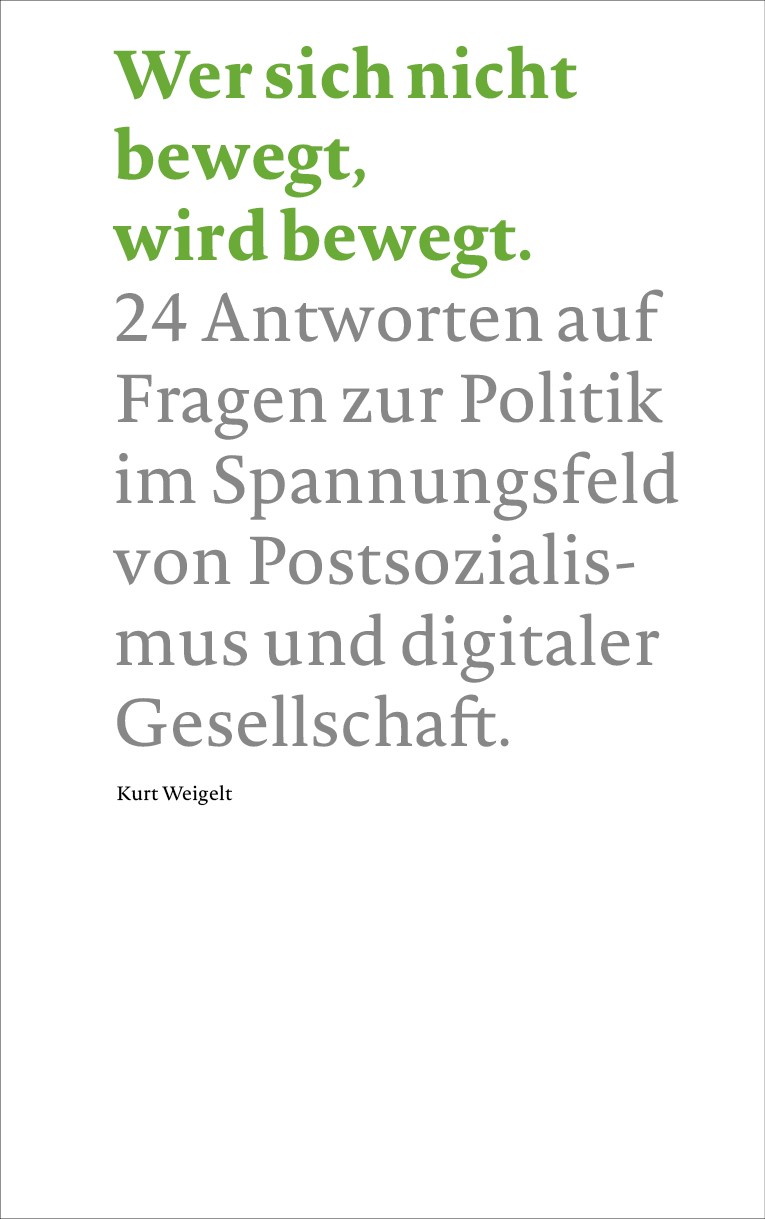Die Eidgenossenschaft im 21. Jahrhundert
Eine alte Idee für eine neue Zeit
Eine alte Idee
Das genossenschaftliche Staatsverständnis macht seit Jahrhunderten den Sonderfall Schweiz aus. Die alte Eidgenossenschaft war als eine Verbindung von unterschiedlichen, aber gleichberechtigten Stadt- und Länderorten organisiert. Demografische, ökonomische und militärische Unterschiede spielten bei der Entscheidfindung keine Rolle. Im genossenschaftlichen Staatsverständnis geht es nicht um Einheitlichkeit, sondern um die heute in der Präambel der Bundesverfassung angesprochene Vielfalt in der Einheit. Das zweite konstituierende Element war das wechselseitige, durch einen Eid gefestigte Versprechen der gegenseitigen Selbsthilfe. Der Treueschwur galt den Miteidgenossen und nicht einem Herrscher.
Nach dem Untergang der alten Ordnung gelang es nach vielen politischen Wirren, das genossenschaftliche Staatsverständnis in das industrielle Zeitalter zu überführen. Die Bundesverfassung von 1848 war kein Bruch mit der Vergangenheit. Durch den Fortbestand der eidgenössischen Orte als eigenständige Kantone und ein Parlament mit zwei gleichberechtigten Kammern verband die neue Bundesverfassung das nationale mit dem föderalistischen Prinzip. Unsere Gemeinwesen sind von unten nach oben aufgebaut. Es gilt das Prinzip der Subsidiarität. Verstärkt wurde diese Kontinuität mit der Einführung der direkten Demokratie im Jahre 1874. Nun hatte das Volk auch bei Sachentscheiden das letzte Wort.
Die schleichende Erosion
In der jüngeren Vergangenheit hat das genossenschaftliche Staatsverständnis viel von seiner Kraft verloren. Die Forderung nach materieller Gleichheit verdrängt den Grundsatz der Chancengleichheit. Selbsthilfe ist für viele zu einem Fremdwort geworden. Das Parlament und die Verwaltung in Bundesbern bestimmen die politische Entwicklung. Der politische Wettbewerb und internationale Verpflichtungen belasten die direkte Demokratie. Die grosse Zahl an Berufspolitikern und Staatsangestellten stellt das Milizsystem in Frage.
Eine neue Zeit
Verspielt werden damit staatspolitische Alleinstellungsmerkmale, die in hohem Masse zukunftstauglich sind. Die Verschiedenheit einer durch die Digitalisierung, die Globalisierung und die Migration geprägten Gesellschaft lässt sich nur mit einem politischen System bewältigen, das auf den Umgang mit Verschiedenheit ausgerichtet ist. Ein Steilpass für das genossenschaftliche Staatsverständnis. Die Schweiz tut gut daran, sich ihrer traditionellen Werte zu besinnen.
Die Eidgenossenschaft als Staatsidee hat Zukunft. Ein von unten nach oben aufgebautes Gemeinwesen ist weit besser auf die Herausforderungen einer fragmentierten Gesellschaft vorbereitet als zentralverwaltete politische Systeme. Verschiedenheit lässt sich nur mit Verschiedenheit bewältigen. Die Zeichen der Zeit stehen auf Chancengleichheit und Selbsthilfe und nicht auf materielle Gleichheit und Umverteilung. Gleichzeitig muss es gelingen, die institutionellen Besonderheiten der Schweiz auf neue Bedürfnisse einzustellen. Dies gilt für die direkte Demokratie, den Föderalismus und das Milizsystem genauso wie für die Zusammenarbeit mit supranationalen Organisationen wie der Europäischen Union. Nicht verhandelbar ist das genossenschaftliche Staatsverständnis. Dieses macht das Erfolgsmodell Schweiz aus und darf keinen kurzfristigen politischen oder wirtschaftlichen Interessen geopfert werden.