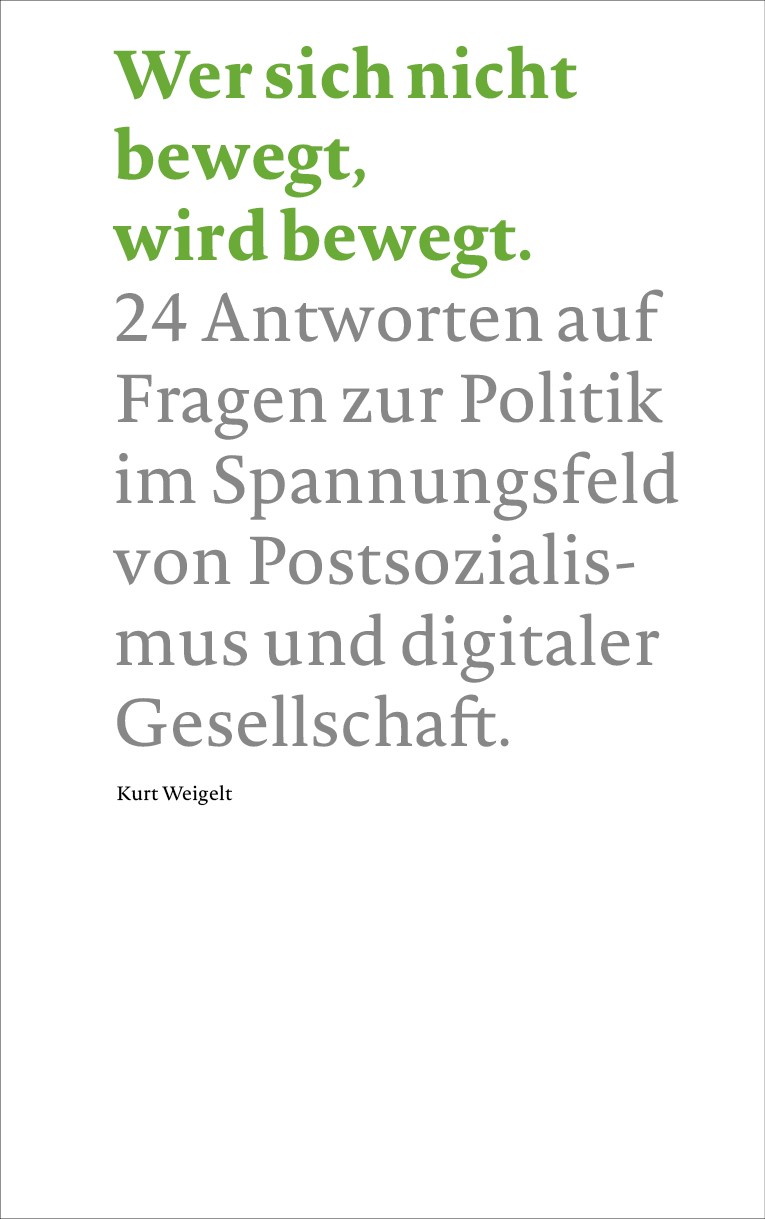Weshalb das politische System den Sonderfall Schweiz ausmacht – und weshalb wir gut daran tun, dafür Sorge zu tragen.
Dies gelesen: «Sonderfall Schweiz – 734 Jahre sind genug.» (Quelle: WOZ, 7.8.2025)
Das gedacht: Es ist wieder einmal soweit. Die reaktionäre Linke erklärt das Ende des Sonderfalls Schweiz. Konkreter Anlass dazu bietet dem WOZ-Redaktor der Zollhammer von Trump.
Bedient werden im Artikel von Kaspar Surber die üblichen Klischees aus den 90er-Jahre des letzten Jahrhunderts:
- Der Sonderfall wird mit der Vorstellung «von einer schicksalhaften, gottgewollten Auserwähltheit seit 1291» in Verbindung gebracht.
- Diesem Bild wird eine Schweiz gegenübergestellt, die vom Sklavenhandel und von kolonialer Ausbeutung profitierte und von Grossbanken, die das rassistische südafrikanische Appartheimregime stützten.
Einseitiger geht es nicht. Jeder halbwegs gebildete Mensch weiss, dass die Schweiz seit jeher mit der ganzen Welt verbunden ist. Ein Beispiel dafür ist St.Gallen, die Heimatstadt des WOZ-Autors.
- Im 9. und 10. Jahrhundert war das Kloster St.Gallen eines der kulturellen Zentren des deutschsprachigen Raums.
- Ab dem 15. Jahrhundert verkauften St.Galler Leinwandhändler ihre hochwertigen Produkte in ganz Europa.
- In der zweiten Hälfte des 19. und anfangs des 20. Jahrhunderts eroberte die St.Galler Stickerei die Welt. Die wichtigsten Exportländer waren Frankreich und die USA.
Die Schweiz hat nie als einsame Insel funktioniert. Schon immer verdienten wir unseren Wohlstand im engen Austausch mit unseren Nachbarländern und der weiten Welt. Gemäss dem KOF Globalisierungsindex gehört die Schweiz heute zu den am stärksten globalisierten Ländern. Dabei versteht sich von selbst, dass es in dieser jahrhundertelangen Geschichte auch dunkle Kapitel gibt.
Die Alleinstellungsmerkmale
Nur, darum geht es nicht. Nicht die weltweiten wirtschaftlichen Verflechtungen mit all ihren Sonnen- und Schattenseiten, sondern das politische System macht den Sonderfall Schweiz aus.
Um dies zu verstehen, genügt ein Blick auf die offizielle Bezeichnung unseres Bundesstaates: Schweizerische Eidgenossenschaft. Der «Eid» und die «Genossenschaft» sind die ursprünglichen Alleinstellungsmerkmale unserer Gemeinwesen.
- Der Eid. Als höchste Form der Selbstverpflichtung eines Menschen stand der gemeinsame Schwur der alten Eidgenossen im Gegensatz zum Untertaneneid feudaler Herrschaften. Der Treueschwur galt den Miteidgenossen und nicht einem Herrscher. Angesprochen ist mit der paritätisch-horizontalen Bindung das Prinzip der gegenseitigen Selbsthilfe.
- Die Genossenschaft. Dem Genossenschaftsgedanken entsprechend war die alte Eidgenossenschaft als eine Verbindung von unterschiedlichen, aber gleichberechtigten Stadt- und Länderorten organisiert. Voraussetzung und Zielsetzung der Mitgliedschaft in der Eidgenossenschaft war nicht die Angleichung der politischen Systeme der einzelnen Orte. Der Respekt vor den unterschiedlichen Verfassungsstrukturen und der Verzicht auf eine starke Zentralgewalt machten das Besondere der Eidgenossenschaft aus.
Von unten nach oben
Mit dem Bundesstaat von 1848 gelang es, wesentliche Elemente der alten Eidgenossenschaft in das industrielle Zeitalter zu überführen. Die neue Bundesverfassung war kein Bruch mit der Vergangenheit.
- Durch den Fortbestand der eidgenössischen Orte als eigenständige Kantone und ein Parlament mit zwei gleichberechtigten Kammern verbanden die Verfassungsgeber das nationale mit dem föderalistischen Prinzip.
- Verstärkt wurde diese Kontinuität mit der Einführung der direkten Demokratie im Jahre 1874. Nun hatte das Volk auch bei Sachentscheiden das letzte Wort.
Die alte Eidgenossenschaft und den Bundesstaat von 1848 verbindet das genossenschaftliche Staatsverständnis. Unsere Gemeinwesen sind von unten nach oben aufgebaut. Dieses staatspolitische Organisationsprinzip unterscheidet die Schweiz fundamental von allen ihren Nachbarländern und macht den Sonderfall aus.
Entwaffnende Ehrlichkeit
Immerhin, in einem Punkt hat der WOZ-Autor Respekt verdient. Mit entwaffnender Ehrlichkeit spricht er an, was es braucht, um den Sonderfall Schweiz zu entsorgen: «Die vordringliche Reaktion auf den Zollstreit ist (…) der Abschluss der Bilateralen III.»
- Ganz anders der Bundesrat und die bürgerlichen Befürworter des EU-Vertragspakets, die ohne rot zu werden behaupten, dass sich mit der institutionellen Anbindung der Schweiz an die EU im Grunde genommen nichts ändert.
- Das Gegenteil ist richtig. Mit der Übernahme von EU-Recht und der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs verabschieden wir uns vom politischen Sonderfall Schweiz. Die Macht verlagert sich in Richtung von Verwaltung und Gerichten. Auf der Strecke bleiben zu einem wichtigen Teil die direkte Demokratie, der Föderalismus und das Milizsystem.
Die Eidgenossenschaft hat Zukunft
Mit der Annahme des EU-Vertragspakets verabschieden wir uns nicht nur vom Sonderfall, sondern riskieren gleichzeitig das Erfolgsmodell Schweiz.
Denn eines ist offensichtlich. Der Schweiz geht es besser als ihren Nachbarstaaten. Die Menschen sind wohlhabender, die Regierungen stabiler, der Staat weit weniger verschuldet, die politische Auseinandersetzung entspannter.
In dieser Erfolgsgeschichte kommt den institutionellen Besonderheiten der Schweiz entscheidende Bedeutung zu:
- Dank der direkten Demokratie und der Autonomie der Kantone und Gemeinden funktionieren in der Schweiz der Wettbewerb der Ideen und die Integration von politischen Minderheiten.
- Dies im Gegensatz zu all denjenigen Gemeinwesen, die – mit den Worten von Hayek – die ganze Gesellschaft zu einer einzigen Organisation machen, die nach einem einzelnen Plan entworfen und geleitet wird.
Vieles spricht dafür, dass dies auch in Zukunft so bleiben wird. Ein von unten nach oben aufgebautes Gemeinwesen ist weit besser auf die Herausforderungen einer fragmentierten Gesellschaft vorbereitet als zentralverwaltete politische Systeme. Verschiedenheit lässt sich nur mit Verschiedenheit bewältigen. Die Eidgenossenschaft hat Zukunft. Wir tun gut daran, dem Sonderfall Schweiz Sorge zu tragen.
Erstpublikation am 26.8.2025 auf www.nebelspalter.ch