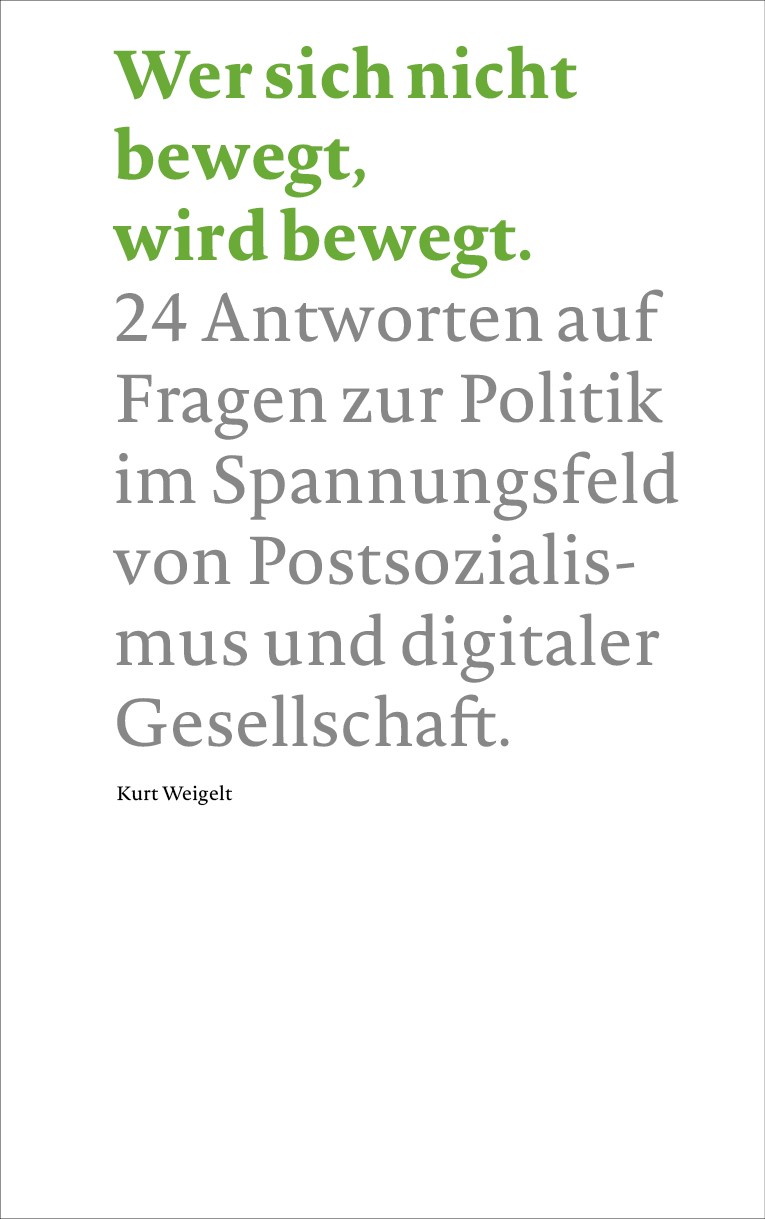Paragraphen statt Menschen
Das Gegenteil von gut ist nicht schlecht, sondern gut gemeint. Auch beim Vollzug der Flankierenden Massnahmen.
Dies gelesen: «Rund 60 000 Geflüchtete in der Schweiz haben zurzeit den Schutzstatus S. (…) Gemäss den neusten Daten haben bisher gut 4600 dieser Geflüchteten eine Arbeitsstelle gefunden.» (Quelle: NZZ, 13.10.2022)
Das gedacht: Kürzlich wollte ein befreundeter Unternehmer eine Frau einstellen, die aus der Ukraine geflüchtet ist. Die Beschäftigung hätte sie von der staatlichen Sozialhilfe unabhängig gemacht. Vor allem aber wäre es die Chance gewesen, rasch möglichst unsere Sprache zu lernen. Die Frau spricht kein Wort Deutsch.
Mein Freund hatte allerdings die Rechnung ohne das Amt für Wirtschaft des Kantons St.Gallen gemacht. Dieses verweigerte die Arbeitsbewilligung mit der Begründung, dass der vereinbarte Lohn nicht den orts- und branchenüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen entspreche. Verwiesen wurde auf den nationalen Lohnrechner.
Der Lohnrechner des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO ist ein Element im Vollzug der im Zusammenhang mit der Personenfreizügigkeit verabschiedeten Flankierenden Massnahmen und soll Lohndumping verhindern. Anhand von sieben Parametern – der Branche, dem Alter, den Dienstjahren, der Ausbildung, der Stellung im Betrieb, der Berufsgruppe und dem Kanton – definiert dieser den Lohn, den ein Schweizer Arbeitgeber seinen Mitarbeitenden zu zahlen hat. So viel zum liberalen Schweizer Arbeitsmarkt. more