Wie der liberale Arbeitsmarkt auf dem Altar der Personenfreizügigkeit geopfert wird.
Dies gelesen: «Der flexible Arbeitsmarkt wird nicht eingeschränkt.» (Quelle: Erläuternder Bericht zum EU-Vertragspaket, S. 214)
Das gedacht: Die Gewerkschaften in der Schweiz haben ein Problem. Sie leiden unter Schwindsucht. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich der Anteil der Gewerkschaftsmitglieder an allen Beschäftigten halbiert. Heute ist nicht einmal mehr eine von sechs angestellten Personen bereit, die Gewerkschaften mit einem freiwilligen Beitrag zu unterstützen. Als Stimme der arbeitenden Bevölkerung fehlt den Gewerkschaften jede basisdemokratische Legitimation.
Nur, für die Gewerkschaftsbosse ist dies kein Problem. Wer braucht schon Mitglieder, wenn man die eigene Organisation mit staatlichem Zwang künstlich beatmen kann? Zum Beispiel mit den flankierenden Massnahmen, dem innenpolitischen Begleitprogramm zur Personenfreizügigkeit. Mit Blick auf den liberalen Arbeitsmarkt ein Trauerspiel in drei Akten:
Erster Akt: Die Volksabstimmung
Im Jahre 200o stimmt das Volk der Einführung des freien Personenverkehrs zwischen der Schweiz und der EU zu. Der Angst vor Lohndruck begegnete man mit flankierenden Massnahmen. In den Abstimmungsunterlagen begründete der Bundesrat diese wie folgt: «Damit ausländische Arbeitskräfte und Firmen das in der Schweiz geltende Lohn- und Sozialniveau nicht missbräuchlich unterschreiten, haben Bundesrat und Parlament griffige Gegenmassnahmen beschlossen». Das Versprechen des Bundesrates war unmissverständlich und fand breite Zustimmung. Im Fokus der flankierenden Massnahmen sollte der Missbrauch der Personenfreizügigkeit durch ausländische Entsendebetriebe stehen.
Zweiter Akt: Der Vollzug
Nach der Volksabstimmung zeigte sich rasch, dass die bundesrätlichen Versprechungen nicht einmal das Papier wert waren, auf dem das Abstimmungsbüchlein gedruckt wurde. Angeführt von den Gewerkschaften und unterstützt von Teilen der gewerblichen Wirtschaft und einem flügellahmen Arbeitgeberverband fokussierte sich die Arbeitsmarktpolizei auf Schweizer Unternehmen und Arbeitsverhältnisse ohne einen Bezug zur Personenfreizügigkeit. Im Jahre 2023 wurden 9000 Entsendebetriebe und 22’000 Schweizer Unternehmen kontrolliert.
Nicht weniger folgenreich waren die als Teil der flankierenden Massnahmen beschlossenen Erleichterungen bei der Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen. Bei Einführung der Personenfreizügigkeit waren rund 350’000 Beschäftigte einem allgemeinverbindlich erklärten Gesamtarbeitsvertrag unterstellt. Heute sind es 1.1 Millionen. Eine Verdreifachung in zwanzig Jahren. Mit der Allgemeinverbindlicherklärung wird ein Gesamtarbeitsvertrag zu einem zwingenden Bestandteil eines privatrechtlichen Arbeitsvertrages, unabhängig vom Willen der betroffenen Parteien. Mehr staatlicher Zwang geht nicht.
Dritter Akt: Das EU-Vertragspaket
Die Gewerkschaften liessen sich die Zustimmung zur Personenfreizügigkeit mit innenpolitischen Zugeständnissen teuer erkaufen. Ein Muster, das mit dem EU-Vertragspaket in die nächste Runde geht.
Künftig sollen bestehende Gesamtarbeitsverträge auch dann allgemeinverbindlich erklärt werden können, wenn die beteiligten Parteien nur eine Minderheit von Arbeitnehmern vertreten. Das Kriterium «ausnahmsweise» fällt weg. Vergleichbares gilt für das Arbeitgeberquorum bei der Weiterführung von bereits allgemeinverbindlich erklärten Gesamtarbeitsverträgen. Der Bundesrat will, dass eine Minderheit der Mehrheit ihren Willen aufzwingen kann.
Es geht aber noch besser. In Zukunft sollen Gewerkschaftsfunktionäre von einem ausgebauten Kündigungsschutz profitieren. Eine alte Forderung der Gewerkschaften ohne jeden Bezug zur Personenfreizügigkeit. Nach den Gewerkschaften als Organisation erhalten künftig auch die einzelnen Gewerkschaftsfunktionäre eine staatlich abgesicherte Sonderstellung. Dies getreu dem Grundsatz, dass alle gleich, einiger aber gleicher sind.
Ein fragwürdiges Spiel
In den Abstimmungsunterlagen zur Einführung der Personenfreizügigkeit führte der Bundesrat das Stimmvolk hinters Licht. Was damals als flankierende Massnahmen verkauft wurde, hatte mit dem späteren Vollzug nichts zu tun. In Aussicht gestellt wurde eine gegen ausländische Betriebe gerichtete Missbrauchsgesetzgebung. Erhalten haben wir die zunehmende Verstaatlichung des Arbeitsmarktes.
Ein mehr als fragwürdiges Spiel, das mit dem Rahmenabkommen seine Fortsetzung findet. Die Aussage des Bundesrates im erläuternden Bericht zum EU-Vertragspaket, dass mit den begleitenden Massnahmen der flexible Arbeitsmarkt nicht eingeschränkt werde, ist schlicht und einfach falsch. Die vorgeschlagenen Gesetzesanpassungen sind ein weiterer Schritt in Richtung der Verstaatlichung privatwirtschaftlicher Beschäftigungsverhältnisse. Der liberale Arbeitsmarkt wird auf dem Altar der Personenfreizügigkeit geopfert. Auf der Strecke bleibt damit ein wesentliches Element des Erfolgsmodells Schweiz. Eine Tatsache, an der kein noch so schönfärberisch formulierter erläuternder Bericht und keine staatliche Abstimmungspropaganda etwas ändern kann.
Erstpublikation am 29.7.2025 auf www.nebelspalter.ch

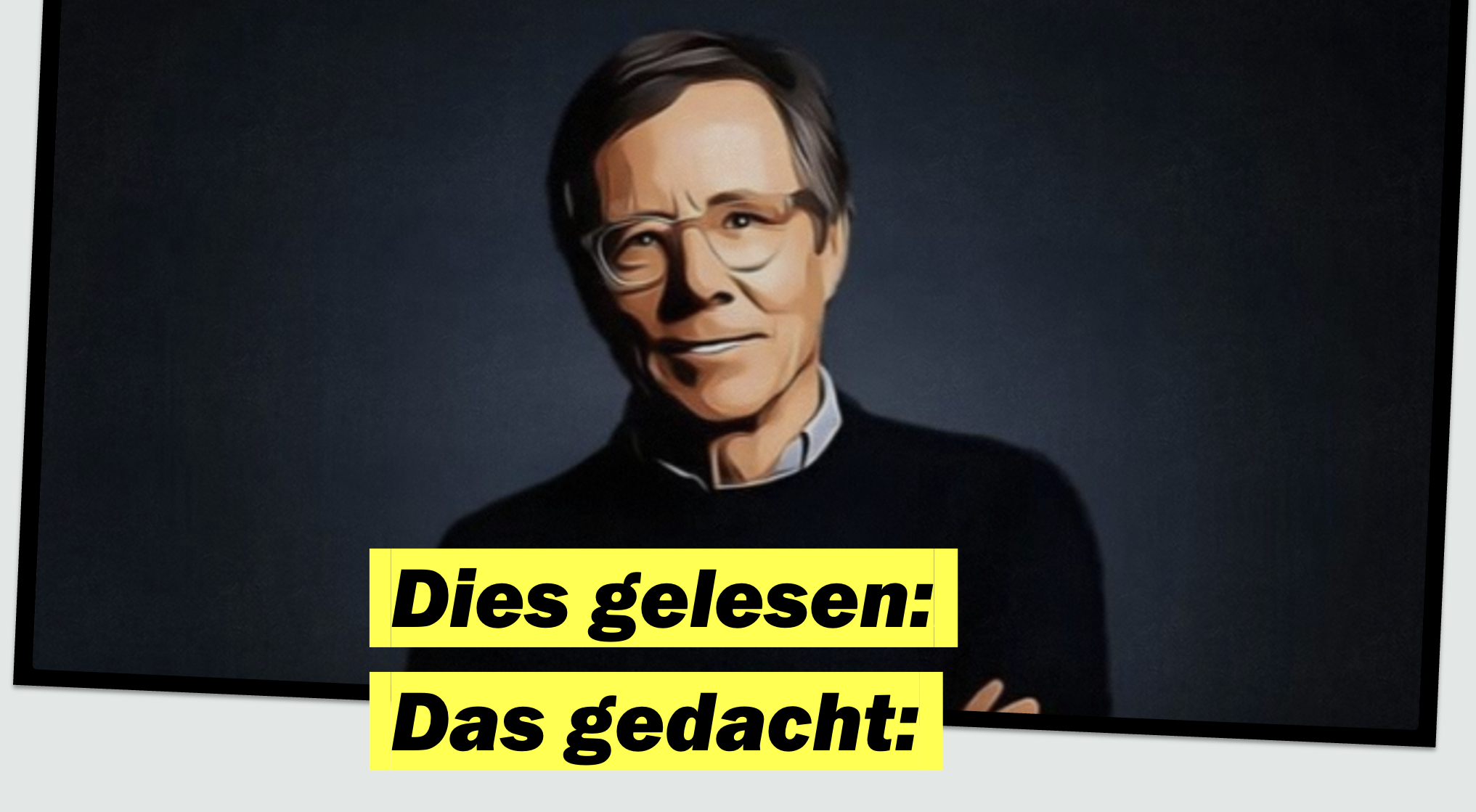
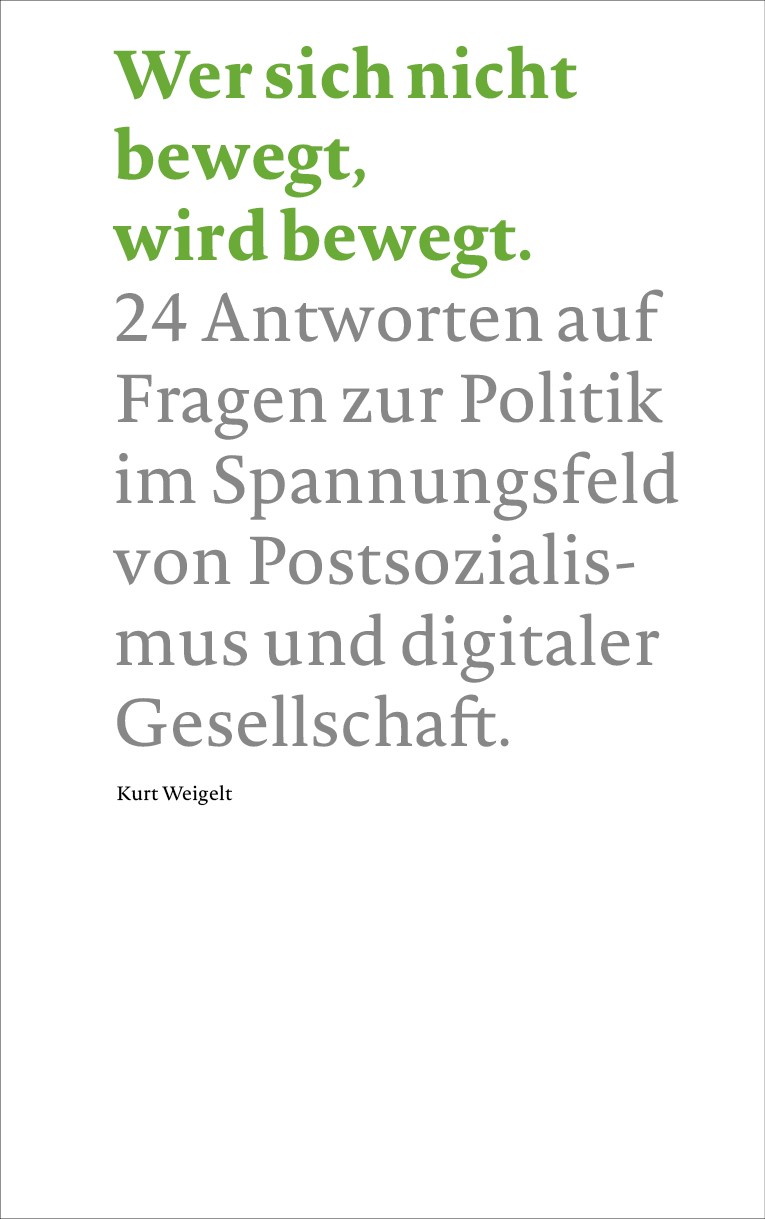
Man kann durchaus verschiedener Meinung sein über die Entwicklung des Schweizer Arbeitsmarkts. Tatsache ist aber, dass die beanstandeten Lösungen von den Sozialpartnern erarbeitet wurden. Der Bundesrat hat diese dann in entsprechende Gesetze und Verordnungen übernommen.
Ob Gesamtarbeitsverträge Segen oder Fluch sind, darüber lässt sich trefflich streiten. Viele Unternehmen schätzen sie, weil sie einheitliche Grundlagen für alle schaffen, andere sehen sich eingeschränkt. Eine «Verstaatlichung» zu konstatieren, ist allerdings völlig überzeichnet. Der flexible Arbeitsmarkt erfährt überschaubare Einschnitte.
Als Argument gegen die Bilateralen III taugen alle diese Beanstandungen nicht. Die Personenfreizügigkeit ist ein Kernstück der Bilateralen Verträge und äusserst wichtig für die Schweiz. Wegen der demografischen Entwicklung sind wir dringend auf sie angewiesen. Uns fehlen wegen der Pensionierung der geburtenstarken Jahrgänge und der schwachen Reproduktion bis ins Jahr 2030 rund 400’000 Arbeitskräfte, 400’000 Steuerzahler und 400’000 Beitragszahler in unsere Sozialwerke. Diese sollten wir aus unserem Kulturkreis holen, also aus dem europäischen Umfeld, und nicht aus Ländern mit anderen Lebensentwürfen, verbunden mit den entsprechenden Integrationsproblemen. Da die umliegenden Länder aber ebenfalls einen Arbeitskräftemangel haben, wird der Kampf um dieselben härter. Dank der Personenfreizügigkeit wird die Schweiz weiterhin auf dieses Reservoir zugreifen können.
UK hat es durchexerziert. Wegen dem Brexit bekommt UK kaum mehr Arbeitskräfte aus Europa und muss die Lücken mit Arbeitskräften aus Afrika und Asien füllen. Wollen wir das auch?
Ja, es ist anspruchsvoll, die Folgen des epochalen Fehlentscheids – dem EWR-Nein vor 35 Jahren – auszubügeln. Die Bilateralen III sind eine gangbare Alternative zum EWR. Nutzen wir sie.