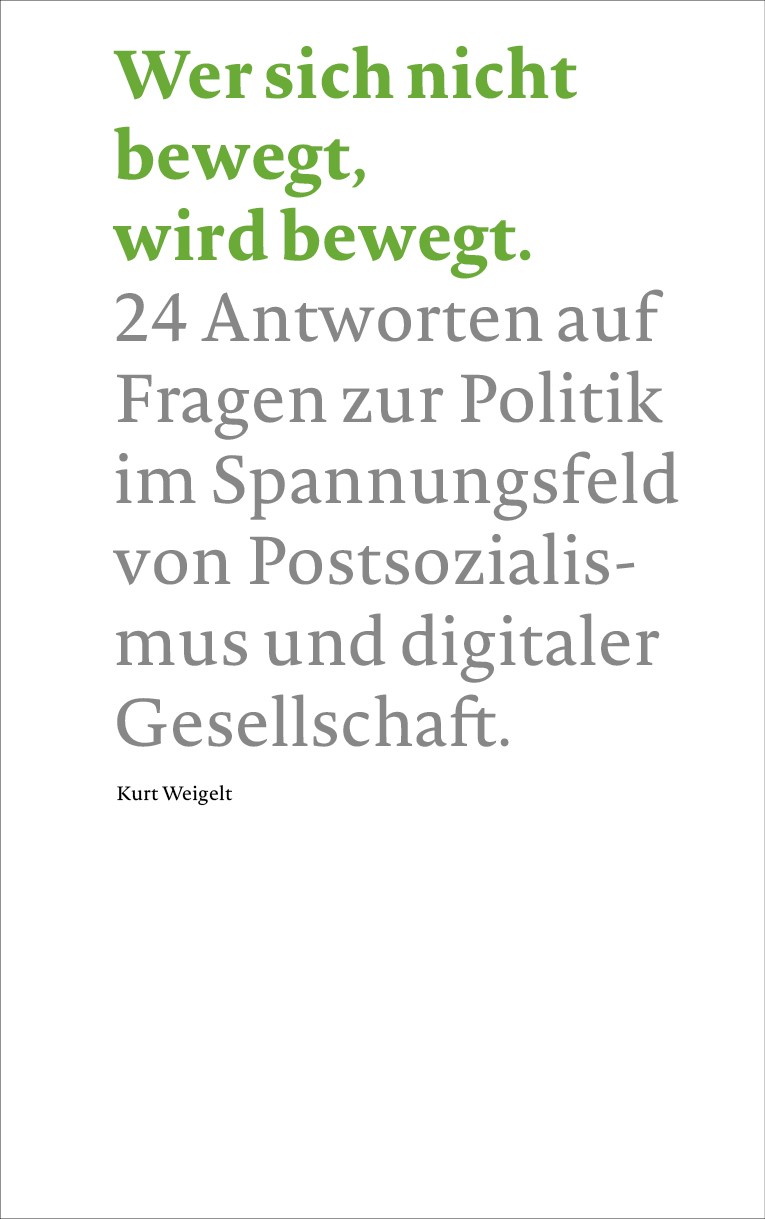Rahmenverträge: Von der schleichenden zur rasanten Machtübernahme durch die Verwaltung
Dies gelesen: «Die Kasse der Stadt St.Gallen ist klamm: Doch die Verwaltung wächst und wächst» (Quelle: tagblatt.ch, 1.12.2025)
Das gedacht: Die Stadt St.Gallen ist definitiv kein Wachstumswunder. Mit Ausnahme der Stadtverwaltung. Diese legt laufend zu. Während der letzten sieben Jahre erhöhte sich die Belegschaft um 200 Stellen und damit um 8,2 Prozent. In der gleichen Zeit wuchs die Wohnbevölkerung um 4,5 Prozent.
Auch die Verwaltung des Kantons St.Gallen beschäftigt heute rund 400 Mitarbeiter mehr als vor sieben Jahren. Der Personalaufwand stieg um über 100 Millionen Franken.
Das Schauermärchen vom Kaputtsparen
Vergleichbares kennen wir nicht nur aus vielen anderen Städten und Kantonen, sondern auch von der Bundesverwaltung. Auch hier gibt es ein strukturelles Defizit. Und auch hier beklagt die reaktionäre Linke, dass der Staat auf Kosten der Staatsangestellten kaputtgespart werden soll.
Ein Schauermärchen. Geht es nach dem bundesrätlichen Budgetvorschlag, dann soll im kommenden Jahr der Personalbestand um weitere 378 auf knapp 39’500 Vollzeitstellen aufgestockt werden.
Arbeit lässt sich wie Gummi dehnen
Diese Entwicklung ist kein Zufall. Bürokratische Strukturen tendieren zur Selbsterhaltung und Selbstverstärkung. Dies gilt für den Staat und die Wirtschaft. Ein Phänomen, das C. Northcote Parkinson vor siebzig Jahren mit Witz und Ironie dokumentierte.
Parkinson zeigte auf, dass sich Arbeit wie Gummi dehnen lässt. Die Zeit, die für eine Arbeit zur Verfügung steht, wird ausgefüllt. Die Zahl der Beamten oder Angestellten, so Parkinson, steht in keiner Beziehung zu der Menge der vorhandenen Arbeit.
Seine Thesen illustrierte Parkinson mit der britischen Militärverwaltung nach Ende des 1. Weltkrieges.
Umstände, die uns bekannt vorkommen:
- Im Jahre 2000 arbeiteten 12’385 Personen für das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS. Heute sind es rund 12’500.
- Allerdings, im Jahre 2000 betrug der Sollbestand 400’000 Armeeangehörige. Heute sind es rund 140’000.
Eine gleichbleibende Zahl an Staatsangestellten verwaltet eine immer kleinere Zahl an Soldatinnen und Soldaten.
Übermacht der Verwaltung
In der veröffentlichten Meinung wird der ausufernde Staatsapparat in der Regel als finanzpolitische Herausforderung diskutiert. In Tat und Wahrheit geht es aber um weit mehr.
Hinter der steigenden Zahl an Staatsangestellten steht immer eine Ausweitung des staatlichen Aufgaben- und Kompetenzbereichs. Im Grunde genommen läuft es auf eine schleichende politische Machtübernahme durch die Verwaltung hinaus.
Bestätigt wird diese Feststellung durch eine in der NZZ zitierte Studie zur Gesetzgebung und Gesetzesqualität auf Bundesebene. Untersucht wurden 447 Gesetzesprojekte und Verfassungsrevisionen. 255 davon gingen auf die Initiative der Verwaltung zurück, also mehr als 60 Prozent.
Nimmt man die Verordnungen hinzu, die in dieser Studie aus technischen Gründen nicht berücksichtigt werden konnten, wird erst recht deutlich, wie gross die Übermacht der Verwaltung ist.
Volk und Parlament als Zuschauer
Die grosse Mehrheit der Gesetzesprojekte widerspiegelt nicht den Gestaltungswillen des Parlaments oder des Stimmvolks, sondern die politische Agenda der Bundesverwaltung. Diese ist, wie das Abstimmungsverhalten der Stadt Bern vermuten lässt, weit links zu Hause.
Eine Entwicklung, die unsere Gemeinwesen von den Füssen auf den Kopf stellt. Das Primat der Verwaltung tritt an die Stelle des Primats der Politik. Besonders deutlich zeigt sich dies bei den EU-Rahmenverträgen.
Um dies zu verstehen, genügt ein Blick in den Erläuternden Bericht zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens. Die ganze Angelegenheit ist derart kompliziert, dass – wenn überhaupt – nur noch einige wenige Experten der Verwaltung den Durchblick haben.
Vor allem aber sind es die institutionellen Regeln, die das Volk und das Parlament auf die Zuschauertribüne verbannen. Die fortlaufende Rechtsübernahme höhlt die Substanz der demokratischen Rechte aus – so Professor Mathias Oesch, der wohl bekannteste EU-Turbo unter den Staatsrechtlern
Von der schleichenden zur rasanten Machtübernahme
Dies alles weiss auch die Verwaltung. Und trotzdem – oder wohl gerade deshalb – wird die staatspolitische Dimension der Rahmenverträge von den verantwortlichen Chefbeamten konsequent heruntergespielt.
Aus verständlichen Gründen. Die dynamische Rechtsübernahme verschiebt die Gewichte in wesentlichen Dossiers endgültig von den gewählten Institutionen zu den Staatsangestellten und zu den Gerichten. Und dies erst noch auf einen Schlag.
Die Rahmenverträge machen aus der schleichenden eine rasante Machtübernahme durch die Verwaltung. Eine Tatsache, die kein bundesrätliches Demokratiemanagement und keine staatlich finanzierte Desinformationskampagne aus der Welt schaffen kann
Literatur: Parkinson, C.N. (1959). Parkinsons Gesetz, Schuler Verlagsgesellschaft Stuttgart
Erstpublikation am 16.12.2025 auf www.nebelspalter.ch