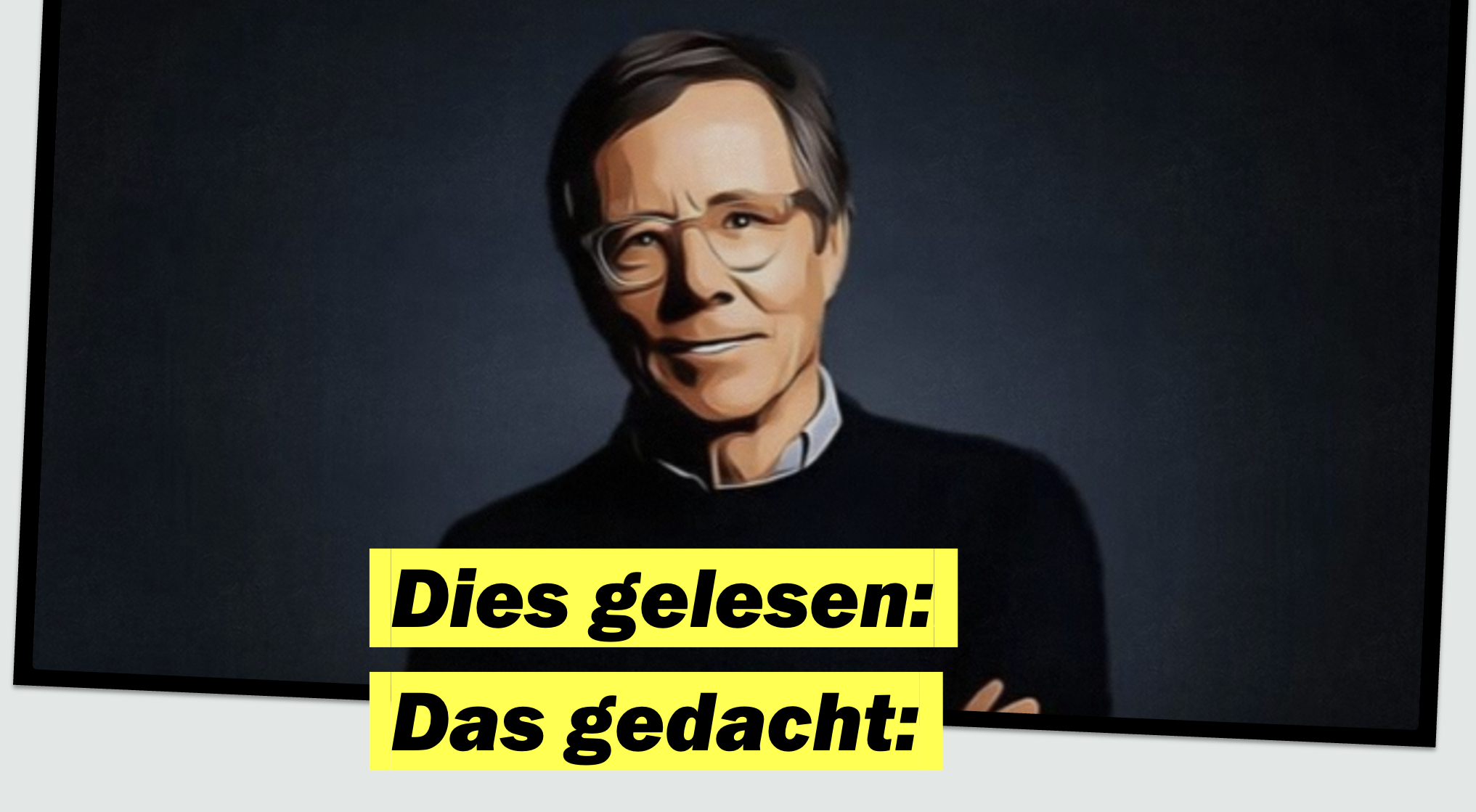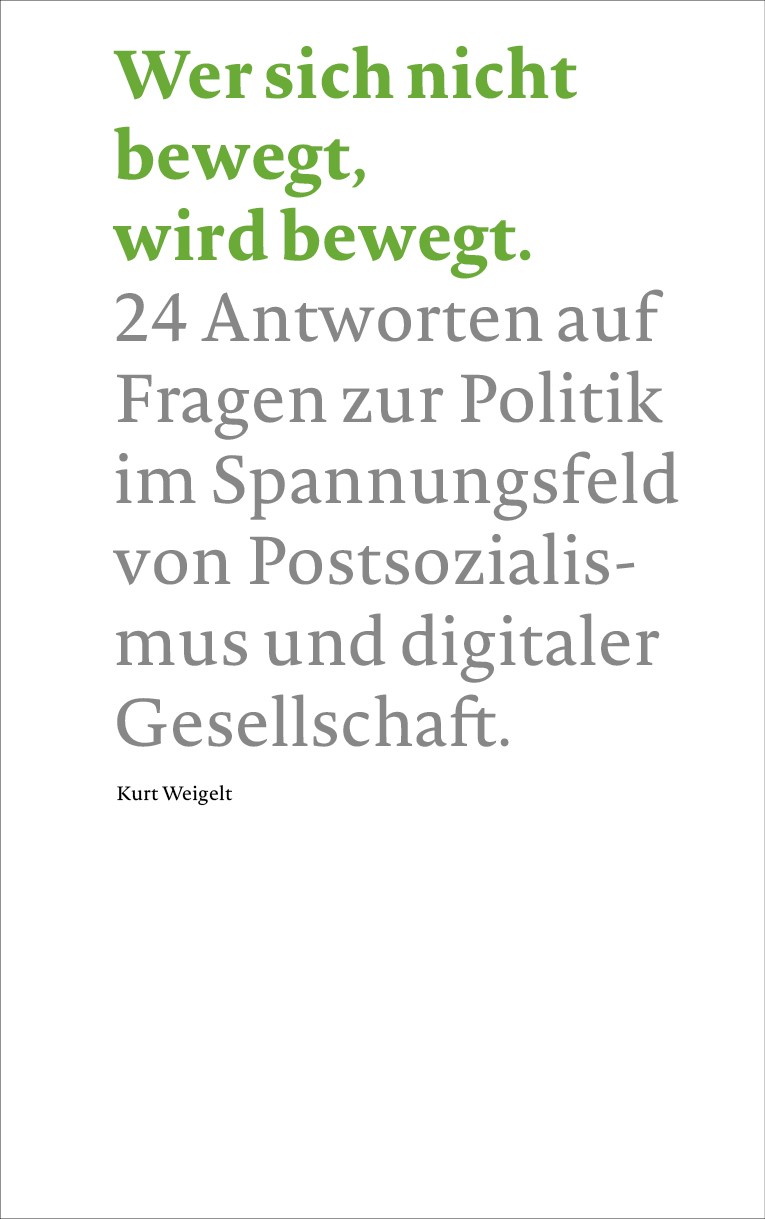Institutionelle Anbindung mit Nebenwirkungen: Der Fall der ETH-Studiengebühren
Dies gelesen: «Das neue Vertragspaket beschert manchen Hochschulen hohe Verluste.» (Quelle: Tages-Anzeiger, 1.11.2025)
Das gedacht: Langsam aber sicher lichtet sich der Nebel rund um das EU-Vertragspaket. Selbst im Tages-Anzeiger. Dies zeigt ein aktueller Artikel zu den finanziellen Konsequenzen der Übernahme von EU-Recht für unsere Hochschulen.
Allerdings beschreibt die Tagi-Journalistin nur die halbe Wahrheit. In Tat und Wahrheit geht es um mehr als um Franken und Rappen. Um dies zu verstehen, muss man die ganze Geschichte erzählen:
Top-Qualität zum Schnäppchenpreis
Die beiden Eidgenössischen Technischen Hochschulen in Zürich (ETH) und Lausanne (EPFL) gehören zu den besten Universitäten der Welt. Gemäss dem Ranking des Fachmagazins «Times Higher Education» ist die ETH Zürich die führende Hochschule Kontinentaleuropas. Angeführt wird die Liste von Universitäten in den USA und in Grossbritannien. Die Universitäten des EU-Raums folgen auf den hinteren Plätzen.
Finanziert wird der ETH-Bereich in erster Linie durch die Steuerzahler. Gemäss dem Finanzbericht des ETH-Rats gab es im Jahre 2024 über die Trägerfinanzierung und Forschungsbeiträge rund 3200 Mio. Franken aus der Bundeskasse.
Vergleichsweise bescheiden waren dagegen die Einnahmen aus Studiengebühren und der Weiterbildung: 61 Mio. Franken. Dies bei Studiengebühren von 1460 Franken pro Jahr. Die ETH Zürich und die EPFL Lausanne liefern ihren Kunden Top-Qualität zum Schnäppchenpreis.
Von Bildungsausländern überrannt
Nirgendwo auf der Welt gibt es für so wenig Geld so viel Bildungsqualität. Die US-Eliteunis beispielsweise verlangen 50’000 bis 60’000 Franken pro Jahr.
Dass angesichts dieser Ausgangslage die beiden Hochschulen von Ausländern überrannt werden, überrascht nicht:
- An der ETH Zürich kamen im Jahre 2000 16 Prozent der Studentinnen und Studenten aus dem Ausland. Heute sind es 40 Prozent.
- In Lausanne stieg der Anteil von 28 auf 60 Prozent. Die überwiegende Mehrheit kommt aus Frankreich.
Höhere Studiengebühren für Ausländer
In der Zwischenzeit hat der Spardruck auch bei den Beratungen zu den Bundesbeiträgen für den ETH-Bereich seine Spuren hinterlassen. Am 12. September 2024 folgte der Ständerat dem Nationalrat und entschied, dass ETH-Studenten aus dem Ausland künftig dreimal höhere Studiengebühren bezahlen müssen.
Auf das Herbstsemester 2025 wurden die Studiengebühren für Ausländer an der ETH Zürich und der EPFL Lausanne verdreifacht. Sie betragen neu 4380 Franken pro Jahr.
Für viele eine Selbstverständlichkeit. Auch für die Studenten aus dem Ausland. Die Erhöhung der Studiengebühren hat zu keinem Rückgang an Anmeldungen geführt.
Brüssel diktiert
Das Schweizer Parlament hat allerdings die Rechnung ohne den Wirt in Brüssel gemacht. Gleichzeitig mit den Diskussionen im Bundesparlament zogen die Verhandlungsdelegationen zum EU-Vertragspaket den differenzierten Studiengebühren den Stecker.
Geht es nach dem am 20.12.24 verabschiedeten EU-Vertragspaket, dann muss die Schweiz künftig bei EU-Bürgern den Nichtdiskriminierungsansatz anwenden. Unterschiedliche Studiengebühren werden von der EU-Bürokraten nicht akzeptiert.
Gemäss dem Staatsekretariat für Bildung, Forschung und Innovation fehlen damit dem ETH-Bereich rund 23 Millionen Franken. Bezahlt werden müssen diese von den Studentinnen und Studenten aus dem Inland oder vom Schweizer Steuerzahler.
Worum es beim EU-Vertragspaket geht
Offensichtlich braucht es das seltsame Gleichheitsverständnis von EU-Funktionären um zu verstehen, dass differenzierte Studiengebühren an hochsubventionierten Hochschulen etwas mit Diskriminierung zu tun haben.
Immerhin, etwas Gutes hat die ganze Angelegenheit. Sie zeigt, worum es bei der institutionellen Anbindung an die EU wirklich geht:
- Die Verlagerung der Entscheidungsmacht von Bern nach Brüssel
Die Diskussionen und Entscheidungen im Schweizer Parlament zu den Studiengebühren von Ausländern waren nicht mehr als eine Luftnummer. Die Musik spielt in Brüssel.
- Die Verlagerung der Entscheidungsmacht vom Parlament an die Verwaltung
Entscheidende Fragen werden nicht mehr von gewählten Volksvertretern, sondern in der Logik der EU-Kommission von Verwaltungsangestellten entschieden.
- Die Verlagerung der Entscheidungsmacht von der Öffentlichkeit in die Sitzungszimmer.
Die Diskussionen zur Anpassung der Studiengebühren in der Schweiz wurden von einer intensiven, fair geführten medialen Diskussion begleitet. Ganz anders der Entscheid in Brüssel. Dieser fiel hinter verschlossenen Türen.
Ein Schaden, der nicht zu reparieren ist
Wirklich bedenklich ist aber nicht nur die angedachte Entmachtung der Schweizer Politik und des Schweizer Volkes. Nicht weniger ärgerlich ist die Dreistigkeit, mit der uns Bundesrat und grosse Teile der Befürworter des EU-Vertragspakets weiss machen wollen, dass sich mit der institutionellen Anbindung an die EU im Grunde genommen nichts ändert.
Das Beispiel der Studiengebühren für Ausländer beweist das Gegenteil. Wer diese Tatsache leugnet, verspielt das Fundamt jeder funktionierenden Demokratie: Das Vertrauen in die Behörden und in die Institutionen. Ein Schaden, der nicht zu reparieren ist.
Erstpublikation am 4.11.2025 auf www.nebelspalter.ch