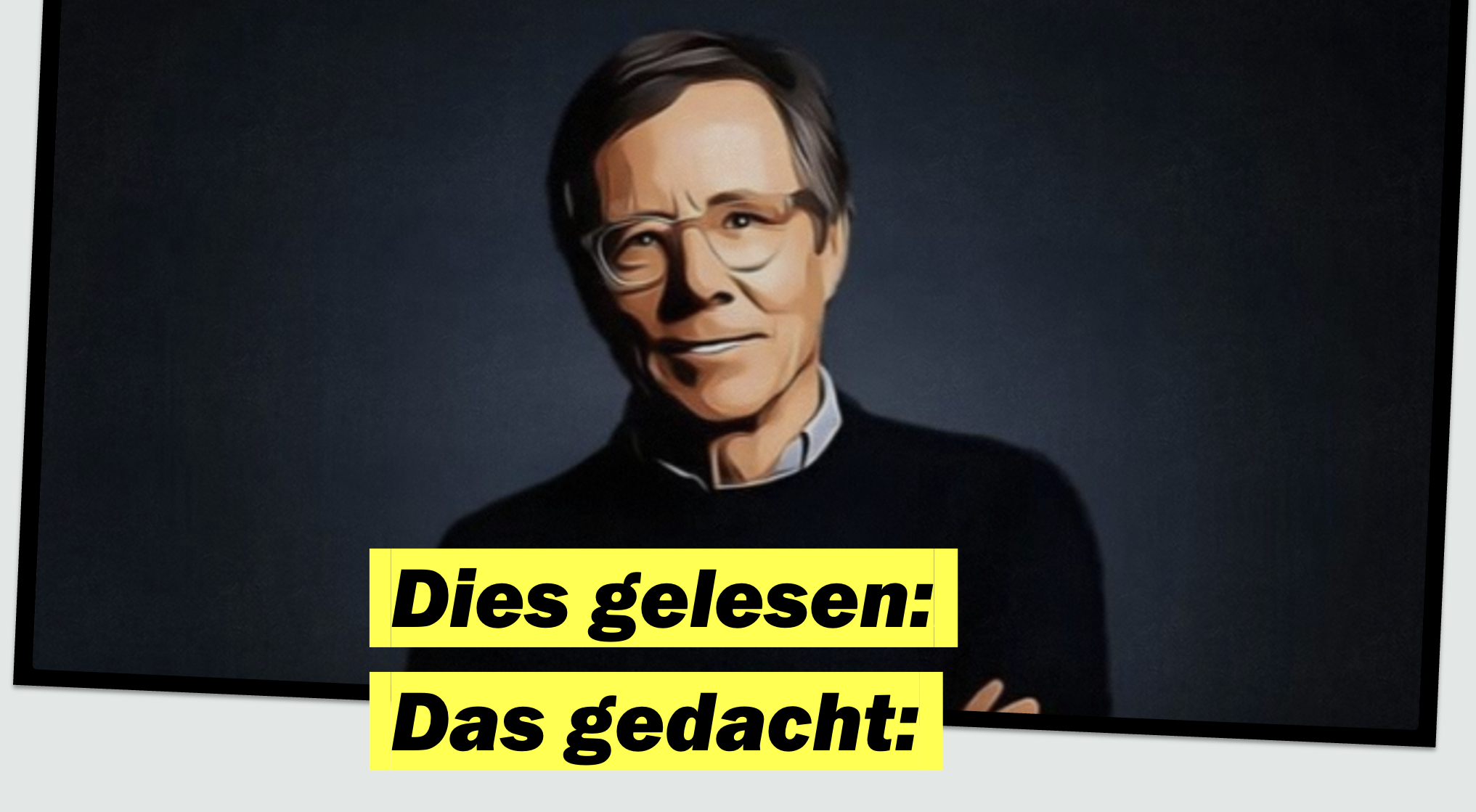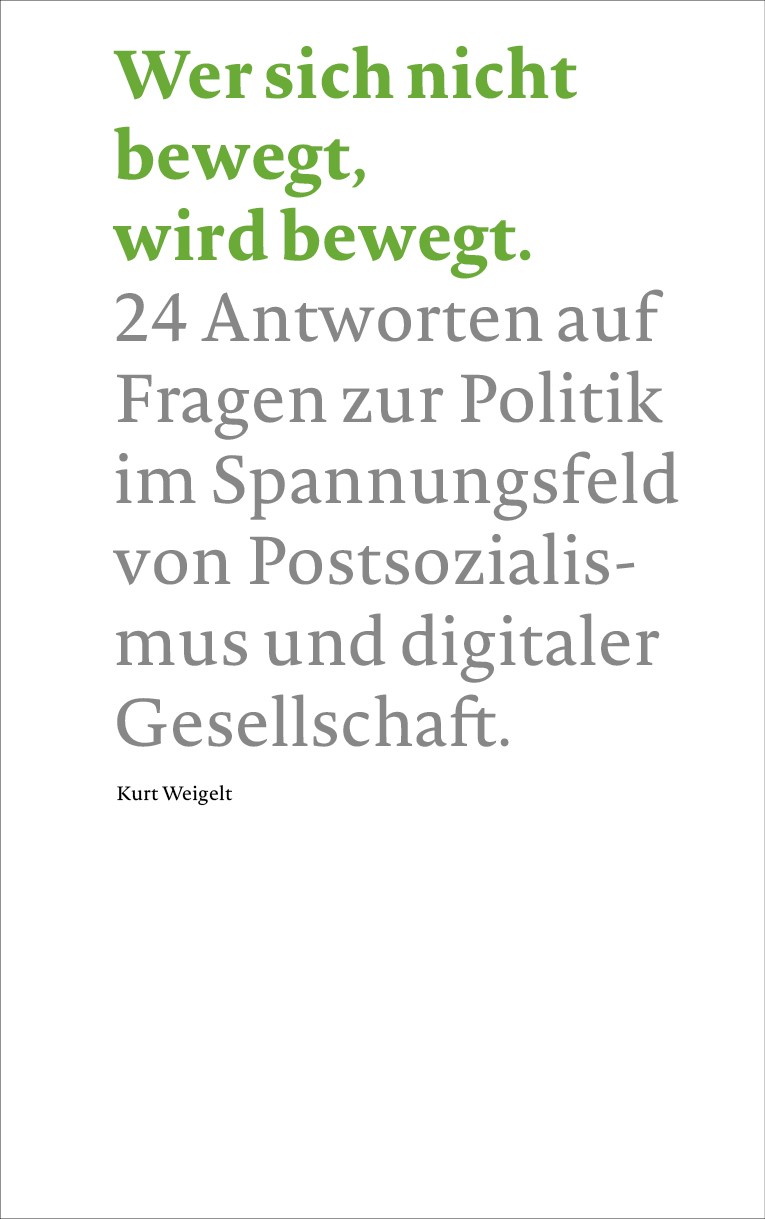Verfassungsbruch mit Ansage: Wie das Vernehmlassungsverfahren dem EU-Vertragspaket geopfert wird
Dies gelesen: «Die Kantone, die politischen Parteien und die interessierten Kreise werden bei der Vorbereitung wichtiger Erlasse und anderer Vorhaben von grosser Tragweite sowie bei wichtigen völkerrechtlichen Verträgen zur Stellungnahme eingeladen.» (Quelle: Bundesverfassung Art. 147)
Das gedacht: Der verfassungsmässige Auftrag ist glasklar. Die Bundesbehörden sind verpflichtet, bei jeder Verfassungsänderung, bei allen Gesetzesvorlagen, völkerrechtlichen Verträgen und bei allen Verordnungen und anderen Vorhaben von grosser Bedeutung ein Vernehmlassungsverfahren durchzuführen. Geregelt sind die Einzelheiten im Bundesgesetz und in der Verordnung über das Vernehmlassungsverfahren.
Sonderfall Schweiz
Das Vernehmlassungsverfahren ist eine unmittelbare Konsequenz der direkten Demokratie. Die Einbindung der Kantone, der Parteien und Verbände in das Gesetzgebungsverfahren zielt darauf ab, durch einen vorgängig erzielten Kompromiss ein späteres Referendum zu vermeiden.
Darüber hinaus macht es die breite Öffentlichkeit zu Beteiligten, erhöht die Legitimation von neuen Vorschriften, entschärft Konflikte und sorgt für politische Stabilität. Das Vernehmlassungsverfahren ist ein entscheidendes Element des politischen Sonderfalls Schweiz.
Dynamische Rechtsübernahme
Und damit soll nun Schluss sein. Geht es nach dem Bundesrat, dann wird die Schweiz in Zukunft in wesentlichen Dossiers die Gesetze und Richtlinien der EU-Kommission und des EU-Parlaments «dynamisch» übernehmen. Die Mitwirkung der Schweiz beschränkt sich auf die Mitsprache von Verwaltungsangestellten im Rahmen des sogenannten «Decision Shaping».
In den wenigen Fällen, in denen die neuen EU-Vorschriften eine Gesetzesänderung in der Schweiz erfordern, gilt weiterhin das Referendumsrecht. Das Schweizer Volk kann ja oder nein sagen. Mehr nicht.
Unhaltbare Mogelpackung
Auf der Strecke bleibt das Vernehmlassungsverfahren. In dreifacher Hinsicht eine unhaltbare Mogelpackung:
- Die Vernehmlassung zum EU-Vertragspaket ist keine Vernehmlassung
Das Vernehmlassungsverfahren gibt den Kantonen, Parteien und Verbänden die Möglichkeit, Änderungen vorzuschlagen und so auf den Inhalt eines Gesetzesentwurfes Einfluss zu nehmen. Das EU-Vertragspaket jedoch liegt als pfannenfertiges Endprodukt vor, inhaltliche Korrekturen sind nicht mehr möglich. Entweder ist man dafür oder dagegen. Die innenpolitische Handlungsfreiheit beschränkt sich auf Beruhigungspillen in der Form sogenannter flankierender Massnahmen. Mit einer Vernehmlassung im Sinne der Bundesverfassung hat dies nichts zu tun.
- Der erläuternde Bericht betreibt Desinformation
Im erläuternden Bericht zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens schreibt der Bundesrat, dass «die Verfahren für die dynamische Rechtsübernahme (…) im Einklang mit den bestehenden innerstaatlichen Verfahren» stehen. Dies ist schlicht und einfach falsch. Da wohl kaum ein Bundesrat den 931-seitigen erläuternden Bericht gelesen hat, ist davon auszugehen, dass diese Behauptung Teil der Desinformationsstrategie der Bundesverwaltung ist.
- Die dynamische Rechtsübernahme verletzt die Bundesverfassung
Die EU wird nie eine Vernehmlassung gemäss Art. 147 der Bundesverfassung durchführen. Das Konzept der dynamischen Rechtsübernahme steht im Widerspruch zur Bundesverfassung, ist ein Verfassungsbruch mit Ansage. Korrekterweise müsste Art. 147, so Professor Richli, wie folgt ergänzt werden: «Vorbehalten sind rechtsetzende Bestimmungen, welche die europäische Union im Bereich der Binnenmarktabkommen zwischen der Schweiz und der Union erlässt.»
Materielle Änderung der Bundesverfassung
Wie Professor Richli in seinem Referat am Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik IWP an der Universität Luzern überzeugend darlegt, ändert das EU-Vertragspaket den materiellen Gehalt der Bundesverfassung.
Dies gilt nicht nur für das Vernehmlassungsverfahren (Art. 147 BV), sondern auch für die Gesetzgebungskompetenz der Bundesversammlung (Art. 163), die Verordnungskompetenz des Bundesrates (182) und die Kompetenzen des Bundesgerichts (Art. 189).
Angesichts dieser tiefgreifenden Verschiebungen im institutionellen Gefüge der Schweiz gibt es für den Abstimmungsmodus nur eine korrekte Antwort: Das EU-Vertragspaket ist dem obligatorischen Referendum zu unterstellen. Für die Annahme braucht es das Volks- und das Ständemehr.
Im Schnellzug in Richtung Europa unterwegs
Dass die Befürworter des EU-Vertragspakets aus opportunistischen Gründen für das fakultative Referendum eintreten, ist halbwegs nachvollziehbar. Der Zweck heiligt die Mittel. Auch in der Politik.
Inakzeptabel ist aber, wenn sich der Bundesrat aus politischen und taktischen Gründen gegen das Ständemehr ausspricht. Dies in der Absicht, die Hürden für das EU-Vertragspaket möglichst niedrig zu halten.
Im Gegensatz etwa zu Deutschland ist in unserem Staatsverständnis die Regierung keine parteipolitische Kampftruppe. Auch die Konsensdemokratie ist eine unmittelbare Folge der Volksrechte.
Eine Tatsache, die im Bundesrat und in den Propagandaabteilungen der Bundesverwaltung zunehmend vergessen geht. Offensichtlich sind wir auch in diesem Zusammenhang im Schnellzug in Richtung Europa unterwegs.
Erstpublikation am 18.11.2025 auf www.nebelspalter.ch